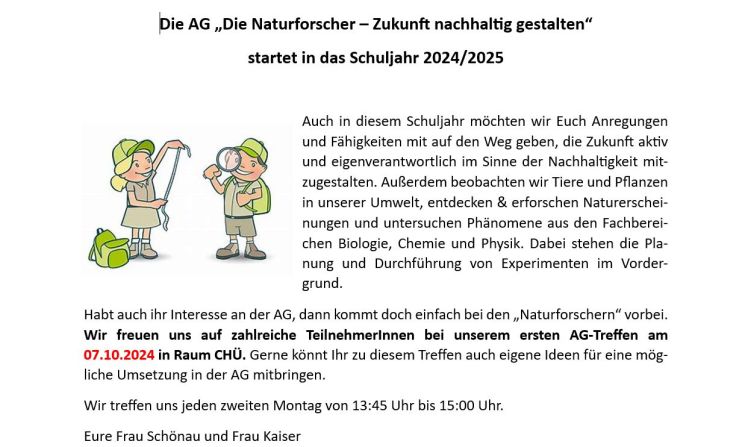Festrede
Lothar Wittmann: Festrede
75 Jahre Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen
Erinnerung und Ausblick
Ein Grußwort, definierte einmal ein erfahrener Redner, solle einen starken Anfang und einen starken Schluss haben, und beide sollten möglichst unmittelbar ineinander übergehen.
Meine Damen und Herren,
nichts läge mir ferner, als damit auf die eben gehörten Grußworte anzuspielen. Dies stünde mir auch nicht zu. Ich möchte lediglich einen Aufhänger finden für das, was das gedruckte Festprogramm nunmehr für Sie vorsieht: eine Festrede. Eine Festrede ist nun aber so etwas Seriöses und Anspruchsvolles, dass es mit einem starken Anfang und einem starken Schluss allein nicht getan ist. Da muss noch etwas dazwischen. Dieses Dazwischen bereitet mir Kopfzerbrechen.
Und deshalb gestehe ich am besten gleich zu Beginn, dass ich mich nicht zu einem Festredner eigne, der in einer hochfliegenden theoretischen Grundsatzrede die staats-tragende Rolle der Schule im Allgemeinen und die Aufgabe des Max-Planck-Gymnasiums im Besonderen darzustellen vermag.
Ebensowenig liegt mir die Rolle des objektiven Historikers, der eine kontinuierliche, lückenlose Chronologie der letzten 75 Jahre dieser Schule mit Akribie vor Ihnen ausbreitet.
Nein: Ich bin ein Beteiligter, ein “Mittäter” sozusagen, denn ich habe acht Jahre meines Lebens an dieser Schule verbracht von Oktober 1945 bis Ostern 1953. Diese Schule, das ist nicht zu leugnen, ist Teil meines Lebens. Deshalb kann mein Versuch, als unmittelbarer Zeitzeuge zu berichten, nicht objektiv sein. Was ich Ihnen in Ausschnitten und Momentaufnahmen vor allem über die Jahre 45 und 53 anzubieten habe, trägt alle Mängel subjektiven Erlebens, ist alles andere als allgemein verbindlich, bleibt fragmentarisch, einseitig, zufällig, willkürlich. Aber solcher Mangel an Verbindlichkeit hat andererseits auch den Vorzug der Unmittelbarkeit und Lebensnähe; es ist persönlich Erlebtes.
Es ist ergänzungsbedürftig durch die persönliche Erinnerung vieler anderer hier im Saal Anwesender, die als Schüler unserer Schule Ähnliches erlebt haben. Aus solchen Mosaiksteinchen individuellen Erlebens bildet sich dann vielleicht unversehens und kaleidoskopartig eine Gesamtansicht, die zwar nicht dem Anspruch der Objektivität gerecht wird, aber doch eine Annäherung an die komplexe Wirklichkeit ergibt. Meine Absicht war es, durch Bilder, Szenen, Eindrücke das Lebensgefühl dieser Nachkriegsjahre zu vergegenwärtigen.
In der Erinnerung haftet ein halb zerstörtes Schulgebäude an der Leuschnerstraße – die übrigens kurz vorher noch Ostmarkstraße hieß – : stark beschädigtes Dach, nach Westen um eineinhalb Stockwerke durch Bombentreffer dezimiert, kaum intakte Fenster, mehr Ruine als Schulhaus. Dennoch wird der Schulbetrieb hier im September 45 wieder aufgenommen. Ich bin im Oktober 45 von der Evakuierung im Pfälzerwald zurückgekehrt und in die erste Klasse (nach heutiger Zählung 5. Klasse) eingetreten. Ich war von Anfang an dabei.
Gegenüber der Schule auf der anderen Seite der Allee das nackte Betongerippe der Kuppel- und Turmkonstruktion der halb zerstörten runden Friedenskirche – Mahnmal des Bombenkrieges.
Seitlich von der Schule auf der anderen Seite der Fichtestraße ein Sportplatz mit rotem Splitt. Auf ihm haftet die Erinnerung besonders liebevoll: Es ist das “rote Plätzel”, eine Wiege des Ludwigshafener Nachkriegsfußballs. Bei Unterrichtsausfall darf dort gekickt werden. Dribbeltalente werden hier entdeckt. Wer je dort gespielt hat, spricht vom “roten Plätzel” nur mit leuchtenden Augen. Der schönste Sportplatz der Welt, Zuflucht vor jedem Schulfrust.
Dies war der Schauplatz des Neuanfangs 1945. “Das einfache Leben” hieß ein in den ersten Nachkriegsjahren erschienener Roman von Ernst Wiechert. Und es war äußerst einfach, das schulische Leben dieser Jahre: Einfach nicht im Sinne von problemlos, sondern von karg, ja primitiv. Zu den “einfachen” und ersten Aufgaben einer Klasse gehörte das Wegräumen des Bombenschutts im Klassensaal. Scheibenlose Fensterrahmen werden mit Brettern oder Karton vernagelt, Fensterglas ist Mangelware. Legendär die beispielhafte Instandsetzung des Klassenraums durch die Klasse, in der Helmut Kohl saß; er hat die Wiederherstellung organisiert inklusive der erfindungsreichen Beschaffung von Baumaterial. Dem gelungenen Werk zugrunde lag ein Gentlemen’s Agreement mit der Schulleitung: Die Klasse repariert und erhält dafür ein “Dauerwohnrecht”. Der geheime Clou: Der Saal liegt ebenerdig, ermöglicht den exklusiven Ein- oder Ausstieg durchs Fenster.
Im Winter 1945/46 waren primitive Kanonenöfen die einzige Heizmöglichkeit in den Schulsälen. Die besten Plätze waren in Ofennähe. Heizmaterial durch Selbstversorgung: Jeder Schüler hatte die Auflage, ein oder zwei Stück Holz in den Unterricht mitzubringen. Wer mehr mitbrachte, genoss die volle Sympathie des Lehrers.
Historisch belegt ist die Erstürmung von Kohlezügen in diesem Winter durch die frierende Bevölkerung. Nicht belegt ist, ob der Kohlenklau auch zur Erwärmung unseres Klassensaals beigetragen hat. Sicher dagegen ist, dass es der Schule gelang, durch diese Notmaßnahme auf exemplarische und originelle Weise das Bewusstsein für “soziale Wärme” in uns zu wecken. Diese Kanonenofenwärme – obwohl unsere Vorderseite halb geröstet, die Hinterseite kalt war – war eindrucksvoller als jede spätere automatisch geregelte Zentralheizung.
Pädagogisch geradezu genial war in jenen Jahren die Erfindung einer besonderen Schulstrafe. Statt Arrest abzusitzen, musste ein Übeltäter schwere Dachziegel vier Treppen hoch ins Dachgeschoss der Schule schleppen. So gelang die schrittweise Dachdeckung der Schule proportional zur Disziplinlosigkeit der Schülerschaft. Allein mit Musterschülern wäre die Schule wohl nie zu einem fertigen Dach gekommen.
Durchschlagendes Ergebnis: Nach vollbrachtem Werk fühlst Du Dich schweißüberströmt als nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft. Noch Jahre später erfüllte mich ein gewisser Stolz, wenn ich das Dach des Max-Planck-Gymnasiums betrachtete. Mein Beitrag dazu war erheblich.
Weniger beschwerlich war die Buße für kleinere Sünder: Die mussten lediglich einer Tätigkeit nachgehen, die die amtliche Bezeichnung “Backstein-Klopfen” trug. Um Backsteintrümmer für die Schulsanierung wieder verwertbar zu machen, musste man sie mit einem Hammer vom Mörtel befreien. Hier erfuhr man exemplarisch den enormen Unterschied zwischen ablösbarem Kalkmörtel und zähem Zementmörtel. Eine Lektion für die kleinen nützlichen Dinge des Lebens.
Fast ein Mythos, dessen ich mich mit einer gewissen Zärtlichkeit und Rührung erinnere, war die Einrichtung der Schulspeisung, auch Quäkerspeisung genannt. Sie milderte für uns Schüler die katastrophale Ernährungslage. Diese Speisung bestand entweder aus einer eiweißreichen Sojabohnensuppe oder aus einer Linsensuppe oder aus einer süßen Suppe, hergestellt aus Milchpulver und Rosinen. Und so kamen wir nicht nur mit unserem Schreibzeug, sondern auch mit einem blechernen Essgeschirr aus Beständen der Wehrmacht oder der US-Army in die Schule. Unvergesslich ist mir diese Suppenspeisung aus einem ganz trivialen Grunde. Denn auf der Suppenbrühe schwammen meist sehr niedliche und allerliebst gekrümmte Maden, auf die die Klassenkameraden durchaus unterschiedlich reagierten. Für robustere Gemüter handelte es sich hier um eine zusätzliche “Fleischration”, die sie grinsend und todesverachtend auslöffelten. Die zärteren Gemüter schöpften diese niedlichen Geschöpfe fein säuberlich ab, bevor sie sich etwas verunsichert den Rest der Suppe zu Gemüte führten. Auf die Suppe ganz zu verzichten, konnte sich keiner von uns leisten.
Für meine Person muss ich gestehen, dass ich durch dieses frühe Suppenerlebnis quasi einen Dauerschaden für mein weiteres Leben davongetragen habe, eine Art Suppentrauma. Dieses Trauma hat mein Verhältnis zu allen künftigen Suppen geprägt: Bei jeder Suppe danach spähe ich auch heute noch unwillkürlich und sicher von tieferen Schichten des Unbewussten gesteuert nach jenen kleinen ominösen Würmchen. Selbst bei einer hochfeinen Crevettensuppe mit Dill-Rahm-Creme beschleichen mich gemischte Gefühle. Dies also mein Schulspeisungskomplex, der jedoch keineswegs meine Dankbarkeit gegenüber den US-Quäkern schmälert.
In diese ersten Nachkriegsjahre gehört auch die Erinnerung an eine besondere Form von Swimming-Pool, die uns in großer Zahl in den Sommermonaten zur Verfügung stand. Auf freien Flächen der Stadt, auch im nahen Ebertpark, gab es zahllose tiefe Bombentrichter, die Grundwasser führten und zu einem schnellen Bad einluden. Mancher von uns hat hier schwimmen gelernt.
Ich stoße auf ein Klassenfoto vermutlich aus dem Jahre 48. Aufgenommen auf der Außentreppe zum Haupteingang der Schule. Auf der rechten Seite ein rundliches Männchen mit Schnurrbart. Seine stramme Haltung und der strenge Blick kontrastieren etwas mit den gemütlich-kugeligen Körperformen. Um es gleich zu sagen: Es handelt sich hier um eine der großen Kultfiguren dieser Schule, nicht wegzudenken aus der Geschichte der Oberrealschule, Star der Erinnerung vieler Schülergenerationen: den Hausmeister. Kaum einer wusste, dass er Müller hieß. Aber schulbekannt, ja stadtbekannt sein Spitzname, eigentlich eher Künstlername: Bauch. Bauch, ein ehemaliger Oberfeldwebel, an seinem militärischen Schritt war die Wichtigkeit seiner Person und Funktion abzulesen, eine Mischung aus pfälzer Dorfbüttel und Hauptmann von Köpenick. Alltägliche Durchsagen an alle Klassen stilisierte er zur feierlichen Verkündung des Tagesbefehls hoch. “Ich und der Herr Direktor haben beschlossen…”, lautete einer seiner klassischen Sprüche. Kein späteres Klassentreffen ohne Bauch-Zitate. Unvergessen der Ausspruch: “Wenn ich den erwisch, der auf meim Hund sein Buckel Bauch geschriwwe hat, der kann was erlewe!” Sollte der Übeltäter etwa hier im Saal sein? Bauchs sprachliche Variation des Relativpronomens von absoluter Originalität: “Die Schüler, wu…”. “Derjenige, der” wird sprachschöpferisch umgestaltet in “seller wu…”. Dennoch, oder gerade deshalb, eine liebenswerte Figur, ein echtes Original von unfreiwilliger Komik. Ich vermute fast, dass er auf seine durchschlagende erheiternde Wirkung insgeheim ein bisschen stolz war.
Seltsamerweise nimmt in meiner Erinnerung ein Schulbuch einen besonderen Platz ein, das einzige, das mir aus den Jahren 45 bis 50 erinnerlich ist. Es handelt sich um das “Lehrbuch der französischen Sprache” von Louis Marchand. Noch heute geht von ihm – ein paar antiquarische Bände habe ich sichergestellt – eine merkwürdige Faszination aus. Erstes mir bekanntes konsequent einsprachiges Sprachlehrbuch, hervorragend illustriert, neue Vokabeln nicht übersetzt, sondern mit Bildern erklärt. Bild und Wort sich wunderbar ergänzend und so sich zäh im Gedächtnis einnistend. Der Held dieses Schulbuches ein elsässer Junge, Jean Hickel (sprich Hickel), dem zwei Pariser Familien, M. et Mme Dupont und Durand le bon usage de la langue FranVaise eintrichtern. Dieses methodisch überzeugende Schulbuch war von der französischen Besatzungsbehörde par ordre du Moufti allen deutschen Schulen der Zone verordnet, also aufgezwungen worden. Trotz dieses Zwangs stieß es durch seine Originalität auf viel Sympathie.
Gefördert wurde unser Französisch in oberen Klassen u.a. von einer sehr anmutigen jungen Sprachassistentin aus Paris, die mit uns sogar den klassischen Racine zu lesen versuchte. Wir übten Szenen mit verteilten Rollen, bis dann eines Tages einem von uns die Rolle des unglücklichen Liebhabers zufiel. Böse Zungen behaupten, ich hätte diese Rolle übernommen. Als dann dieser unglücklich Liebende, vermutlich ganz in der Rolle aufgehend, wie der Text es vorschrieb auf diese hübsche Studentin zustürzte, ständig stammelnd “je t’aime, je t’aime”, muss das auf sie so echt und entschlossen gewirkt haben, dass sie panikartig den Saal verließ. Leider tauchte diese reizende kleine Lehrerin nicht mehr in unserer Klasse auf. Ein Exempel, wie weit Theaterleidenschaft führen kann. Wir waren traurig über diesen abrupten Abgang.
Die Szenerie der Nachkriegsjahre in unserer Oberrealschule wäre unvollständig, wenn eine Einrichtung nicht erwähnt würde, die schuld daran war, dass wir weder Turnhalle noch Aula hatten. Der Anbau der Schule, heute Aula, wurde auf Kosten des Betreibers zu einem Kino umgebaut, die “Kurbel”. Diese Tatsache für sich wäre wohl kaum erwähnenswert, hätte es in diesem Kino nicht eine für uns Schüler einmalige Attraktion gegeben: Die besten Plätze bestanden aus gepolsterten Doppelsitzen in der letzten Reihe des Hochparterres, wunderbar geeignet für ein trautes Schäferstündchen zu zweit. Ich erinnere mich an den Kassenschlager “Sie tanzte nur einen Sommer” mit Ulla Jakobson. Von dem Film selbst habe ich allerdings nicht viel mitbekommen.
Tanzstundenzeit. In der 7. (sprich 11.) Klasse war es so weit: Wir entdeckten die harmonische Welt rhythmischer Zweisamkeit, Paartanz genannt. Wenn schon tanzen, dann aber gründlich nach allen Regeln der Kunst. Das bedeutete, beim ersten Tanzmeister der Stadt einen Tanzkurs zu organisieren. Die Partnerinnen sollte uns eine Klasse des Mädchengymnasiums liefern. Mit einer kleinen Abordnung unserer Klasse trugen wir unser Anliegen dem Direktor des Mädchengymnasiums vor. Dies war ein ausgesprochen gutmütiger Mensch. Welche der drei 5. Klassen wir denn vorzögen? Unsere scheinheilige Antwort: Wir wüssten nicht so recht, und ob wir die Parallelklassen denn besichtigen dürften? Wir durften. Also beäugten wir im Auftrag unserer Klasse ausgiebig und genussvoll diese Ansammlung erblühender Schönheiten und wählten schließlich jene Klasse, die wir von Anfang an im Sinn gehabt hatten.
Aus der Tanzstunde selbst ist mir ein Bild in zwiespältiger Erinnerung: Auf der rechten Seite des Tanzsaals eine Reihe von Stühlen für die Damen, auf der linken das Gleiche für die Herren, dazwischen die Tanzfläche: glattes Parkett. Wenn der Tanzmeister das Kommando “engagieren” gab, ging kreuz und quer ein Wettrennen um die Schönsten der Schönen los. Diese wilde Hatz führte zu Stürzen auf dem gewachsten Boden. Oh erste traumatische Erfahrung auf glattem Parkett: Kläglich zu Füßen der Erwählten zu liegen, während der grinsende Rivale sie mit galanter Verbeugung in Beschlag nimmt! Merksatz für später: Wenn Du auf glattem Parkett Dich dem Weibe näherst, überstürze nichts!
Meine Damen und Herren,
ich hätte großes Verständnis dafür, wenn diese Aneinanderreihung scheinbar belangloser Bilder, Szenen, Tatsachen aus den Nachkriegsjahren unserer Schule Ihnen zu ungeordnet, zu subjektiv, zufällig, ja z. T. unwichtig erschiene. Sollte sich ein Festredner nicht etwas mehr an seriöse, allgemein interessierende Fakten und Daten halten? Es tut mir leid: Schuld daran ist ausschließlich die Erinnerung, die ihre eigenen rätselhaften Wege geht. Ihre Filter scheiden nach verborgenen Kriterien die Ereignisse in wichtige und unwichtige. Die Bilder der Erinnerung sind einfach da, ohne dass in ihrer Abfolge ein roter Faden zu erkennen wäre. Vielleicht ist das, was in uns bleibt als Erinnerung, das, was letztlich unsere Entwicklung in ihrer Substanz geprägt hat.
Der politische Neuanfang nach 1945 spiegelt sich auch im Leben der Schule. Ich erinnere mich an eine Gruppe von Kriegsheimkehrern im Frühjahr 1946. Sie nahmen an einem Schnellkurs zur Nachholung des Abiturs teil. Alle hatten Fronterfahrung und der Krieg hatte ihre Gesichter gezeichnet. In den Pausen standen sie in ihren alten Uniformteilen immer an einem sonnigen Plätzchen an der westlichen Stirnseite des Schulgebäudes. Unvergessliche Szene in der Frühlingssonne: Ein Kursteilnehmer, an die Mauer gelehnt, raucht in stoischer Ruhe eine Selbstgedrehte. Der aufsichtführende Lehrer herrscht ihn im Befehlston an, das Rauchverbot zu beachten. Der Angesprochene wortlos, unbeeindruckt, spuckt die Kippe dem erzürnten Lehrer vor die Füße – und schickt sich an, die nächste Zigarette zu drehen. Dabei fixiert er, immer noch ohne ein Wort, den Lehrer mit einem langen, verächtlichen Blick. Dieser Blick muss durchdringend gewesen sein; denn zur Überraschung von uns jüngeren Zuschauern ließ der aufgebrachte Lehrer sofort von dem Raucher ab. Von da an gab es so etwas wie eine stillschweigende Raucherlaubnis für die Heimkehrer.
Auch für uns jüngere nahm die Auseinandersetzung mit Krieg und Nationalsozialismus die Form gelegentlicher Konfrontation mit den Lehrern an. Genauso wie wir die Elterngeneration kritisch nach ihrem Verhalten in der Zeit des Nationalsozialismus befragten, entschied sich unser Verhältnis zu einem Lehrer am gleichen Kriterium. Als unbekehrte Nazis wurden Lehrer eingestuft, die im Barras- und Kasernenhofton mit uns umzugehen versuchten. Schulbekannt waren Umerziehungserfolge an Lehrern in der Klasse von Helmut Kohl. Helmut Kohl brach die Diskussion vom Zaun. Die meisten Lehrer lenkten ein. Es gab auch Unbelehr- und Unbekehrbare, die sich jedoch nicht lange bei uns halten konnten.
Ich erinnere mich, dass wir in einem hartnäckigen Fall einen Lehrer mit Goebbels- und Schirachsprüchen bekehrten, die wir groß an die Tafel geschrieben hatten: Ein deutscher Junge müsse sein “flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl” und “ein deutscher Junge” lebe “von Waldluft und Schwarzbrot”. Dieser Wink mit dem Zaunpfahl verfehlte dann schließlich nicht seine Wirkung.
Zur inneren Verfassung der ersten Nachkriegsjahrgänge der Schule gehörte die frische Erinnerung an den miterlebten Bombenkrieg. Die meisten von uns hatten das Inferno der verheerenden Bombennacht vom 5. auf den 6. September 1943 mit der brennenden Stadt Ludwigshafen selbst erlebt. Wir kannten die Not der Fliegerangriffe, hatten im Luftschutzkeller Männer vor Angst wimmern und Frauen beten gesehen. Und noch heute geht mir eine jaulende Sirene wie das Auf und Ab des Fliegeralarms durch Mark und Bein. Und immer noch wirkt auf mich der langgezogene Sirenenton, der damals Entwarnung anzeigte, beruhigend und erlösend. Der Krieg hatte uns sein Stigma aufgedrückt und in den Familien seine Spuren hinterlassen: relativ viele allein erziehende Mütter, wo die Väter gefallen oder vermisst oder in Gefangenschaft waren. Wir waren sozusagen alle gereift vor der Zeit.
Die Frage der Kollektivschuld, in jenen Jahren (und bis in die Gegenwart) ein heißes politisches Thema, war auch in unserem Deutsch- und Geschichtsunterricht ein wichtiger Diskussionspunkt. Wir lehnten leidenschaftlich den Gedanken einer Kollektivschuld ab, weil wir frei sein wollten von geerbter Vorbelastung und Vereinnahmung. Kollektivschuld – das war doch ein Stück Fremdbestimmung, reichte höchstens bis zur Verant-wortung der Elterngeneration.
Das Recht auf “freie Selbstbestimmung” nahmen wir wörtlich und ganz persönlich.
Aus dieser Grundhaltung erklärt sich die eigentümliche Faszination, die die Hymnen des Sturm und Drang auf uns ausgeübt haben. Protesthaltung, Aufbruchstimmung, Selbstbefreiung: Das war die Tonlage z. B. von Goethes “Prometheus”, die voll unser Lebensgefühl traf. Noch heute haften im Gedächtnis Sätze wie: “Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn‘ als Euch Götter”. Oder der fulminante Schluss:
“Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.”
Es gab auch andere geistige Väter, zu denen uns unser einfühlsamer Deutschlehrer Viktor Schmitz behutsam geführt hat: Hölderlin, George, Rilke. Wir lasen viel zwischen 1945 und 1953 noch ungestört vom Fernsehen: Borcherts “Draußen vor der Tür”, Wiecherts “Missa sine nomine”, Bergengruens “Großtyrann”, Hesses “Narziß” und sein “Glasperlenspiel”, Thomas Manns “Zauberberg”, manches Frühe von Böll. Und vor allem Hemingway, immer wieder Hemingway. “Wem die Stunde schlägt” – das war für uns die schönste Geschichte der Welt, und alle waren wir in die Heldin der Verfilmung verliebt, in Ingrid Bergmann und das blonde Stoppelfeld ihres kurzen Haares.
Es ging weiß Gott nicht immer hochpoetisch zu in unserer Schule. “Die skeptische Generation” nannte Helmut Schelski in seinem berühmten Buch unsere Jahrgänge.
Die ersten Jahre der Nachkriegszeit waren Hungerjahre. Das Wort Hunger war für uns ein Stück erlebter Alltag, gefüllt mit konkreter Erfahrungswirklichkeit – kein Abstraktum wie später für unsere Kinder und Enkel. Viele von uns mussten mithelfen, die Familie zu ernähren: Ähren lesen, Kartoffeln stoppeln. Die private Kaninchenzucht, mitunter sogar in der häuslichen Badewanne, kam in Blüte.
Erst als dann mit der Währungsreform die Ernährungslage sich schlagartig besserte, gab es neben der geistigen Nahrung Lebensmittel in ausreichendem Maße. Sich satt essen zu können nach Herzenslust, war ein neues und wunderbares Erlebnis. Unser Heißhunger hatte geradezu eine existentielle Dimension. Aus dieser Zeit stammt unsere Vorliebe für die großen einfachen Genüsse: Bratkartoffel mit Griebenschmalz und Zwie-beln zubereitet, schöne braune Krusten, das war ein Traum, der nun erfüllt werden konnte. Wie mit Leuchtziffern im Gedächtnis eingegraben die damaligen Preise: Sechzig Pfennige kostete ein Brot mit viel Hausmacher Leberwurst und Salzgurke in einer bestimmten Gartenwirtschaft am Goerdeler Platz. Die Krönung dieser Genüsse beim jährlichen Gärtnerball hier in den Räumen des BASF-Feierabendhauses trug den Namen “Schwedenplatte” und kostete 1,80 DM. Ein Viertel Wein war hier im Feierabendhaus zu erstehen ab 50 Pfennig.
Meine Damen und Herren,
ich bitte um Verständnis, wenn der Festredner Ihnen statt geistigen Höhenflugs und tiefgründiger Bildungstheorie solche Bratkartoffel-Geschichten auftischt. Auch sie sind authentischer Teil unserer Entwicklung und haben ihren legitimen Platz in einer redlichen und nüchternen Bilanz.
Eines haben die Hungerjahre uns als Erbe hinterlassen: ein Bewusstsein vom Wert, auch vom symbolischen, des Brotes. Ich war über 25 Jahre im Lehrberuf; es gab nur eine Situation, in der ich vor Zorn die Fassung verlieren konnte: Wenn ich mit ansehen musste, dass ein Schüler Brot auf den Schulhof warf.
Unser Reifezeugnis datiert vom 2. März 1953. Ausgestellt vom “Staatlichen naturwissenschaftlichen Gymnasium an der Leuschnerstraße”. Die Schule war inzwischen umgetauft. Wie im Namen erkenntlich, dominierten die Naturwissenschaften: Physik, Chemie, Biologie hatten einen wichtigen Platz im Fächerkanon. Willkommener Pate dieser Lehranstalt war die BASF, die viel zur Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume beitrug.
Zirka 90 % unserer Klasse entschieden sich für ein Studium. Davon 50 % für Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften; allein 5 für Chemie, alles Chemiker-Söhne.
Mit der Chemie hatten wir auch während des Studiums zu tun. Wenn in Heidelberg das Semester zu Ende gegangen war, kamen viele von uns als Werkstudenten in der BASF unter. Heilsamer Kontakt mit der Arbeitswelt: Mit eigner Hände Arbeit Geld zu verdienen, das gab ein Gefühl von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Ich begann meine BASF-Karriere als Fensterputzer, rückte dann zum Chemiehilfsarbeiter auf. Mein Betrieb, das berüchtigte Braunoxyd, Herstellung von künstlichem Rost, der als feiner roter Staub in alle Poren drang. Man nannte uns der rotbraunen Farbe wegen einfach “die Indianer”. Fast ein reiner Studentenbetrieb, da diese Arbeit unter echten Anilinern nicht hoch im Kurs stand. Auch bei meiner Mutter nicht, weil trotz ausgiebiger Dusche eine Nacht genügte, um die Betttücher rostbraun zu färben. Sie weigerte sich, jeden Tag die Tücher zu wechseln. Wir arbeiteten 12-Stunden-Schicht. Die Nachtschicht war hart. Wenn gegen drei Uhr morgens der tote Punkt kam, versuchten wir durch donnernde Operetten- und Operngesänge den Schlaf zu vertreiben. Nie war eine Produktion der BASF musikalischer: Da hörte man von trügerischen Frauenherzen, von einer Mondnacht im April, von einem Soldaten am Wolgastrand, von Apfelblüten, von der Ein-adung eines gewissen Herrn Giovanni, mit ihm auf sein Schloss zu kommen.
Manchmal konnte man in der Fabrik dem Werkstudenten Helmut Kohl begegnen. Er hatte seinen BASF-Stammplatz in den Semesterferien in der Steinschleiferei. Das war eine Präzisionsarbeit mit höheren Ansprüchen.
Obwohl wir so während der Semesterferien nur wenig für unser Studium tun konnten, gab es nur wenig Bummler bei diesen Studentenjahrgängen. Wir drängten – auch aus Gründen knapper Finanzen – zu einem möglichst schnellen Studienabschluss. Das Wort Bafög war noch nicht erfunden. Der ewige oder Langzeitstudent ist ein Produkt späterer Jahre, der 68-er etwa. Die “skeptische Generation” wollte Nägel mit Köpfen machen.
Das war unsere Schulzeit im Max-Planck-Gymnasium.
Was bleibt von ihr ? – haben wir uns manchmal gefragt. Viel Sachwissen, viele Details? Wohl kaum! Was bleibt, auf Dauer konserviert in der Erinnerung, das waren Menschen, Gesichter, Charaktere, Schicksale, Begegnungen: ein real wirkender Bildungsfaktor, aber unfixierbar und unqualifizierbar. Wir haben Schule und Leben nie als getrennte Welten empfunden, die Schule war Teil des Lebens, war ein Stück von uns. Deshalb hat uns unsere Schule nicht, wie es so schön heißt, “ins Leben entlassen”, sondern sie hat unser Leben einige Jahre hindurch ausgemacht und wir das ihre.
Die Entwicklung des Max-Planck-Gymnasiums ist auch zu verstehen aus der Tradition der Oberrealschule. Von Otto Hahn, dem Chemiker, ist folgende Anekdote überliefert: Theodor Heuss wollte Hahn dazu bewegen, das Amt des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft zu übernehmen. Als Hahn zögerte, fragte ihn Heuss nach den Gründen. Verschmitzt antwortete Hahn: “Ich bin ja nur Oberrealschüler!”
In Ergänzung zur humanistischen Tradition des Gymnasiums sollte sich die Oberrealschule nicht um die alten Sprachen, sondern um das Rüstzeug der exakten Wissenschaften kümmern. Von hier her kommt der realwissenschaftliche Akzent der Schule.
Obwohl meine Interessen mehr in geisteswissenschaftliche Richtung gingen, habe ich mich in der Oberrealschule nie am falschen Platz gefühlt. Dass meine Schule mir solide Grundkenntnisse in den Naturwissenschaften vermittelte, habe ich immer als eine wichtige Ergänzung und Horizonterweiterung empfunden. Es hat mir später als Philologe nie geschadet, z. B. etwas von der Rolle des Katalysators in der Chemie gehört zu haben oder vom physikalischen Prinzip der kommunizierenden Röhre oder schließlich von der Funktion dominanter und rezessiver Erbfaktoren entdeckt durch die Mendel’schen Gesetze.
Den Weg des Max-Planck-Gymnasiums in den 70-er Jahren habe ich als Leiter des Gymnasiums im Schulzentrum Mundenheim aus der Nähe und quasi als Eingeweihter verfolgen können. Unbeschadet hat die Schule das Jahrzehnt der Gesamtschulideologie und –euphorie überstanden. Das war nicht einfach in einer Zeit, in der das “Lernen ohne Mühe” erfunden und als Ersatz für persönliche Anstrengung das gesellschaftliche Rollenspiel eingeübt wurde. Die alte Volksweisheit “Ohne Schweiß kein Preis” wurde als irrig entlarvt, als reines Instrument der Unterdrückung und Entmündigung.
Der Euphorie folgte Ernüchterung angesichts verheerender Ergebnisse bei objektiver vergleichender Leistungsmessung. Gravierende Defizite gab es vor allem in den Naturwissenschaften. Gott sei Dank war meine alte Schule nie für den faulen Zauber des mühelosen Lernens anfällig. Ihre Reaktion war nüchtern, sachlich, realistisch, wie es dem praktischen Geist der Oberrealschule entspricht. Sie bekannte sich dazu, dass erst die Anstrengung dir deine Möglichkeiten und Grenzen zeigt und der schwer erarbeitete Erfolg tiefere Befriedigung verschafft als der leicht erworbene.
Heute hat das Max-Planck-Gymnasium eine mathematisch-naturwissenschaftliche und neusprachliche Ausrichtung. Nach wie vor gehört es zu seinen Aufgaben, für qualifizierten Nachwuchs in den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, der Informationstechnologie zu sorgen. Dies ist um so dringender, als internationale Leistungsvergleiche der deutschen Schule heute erheblichen Nachholbedarf im mathe-matisch-naturwissenschaftlichen Bereich bescheinigen. Aber auch das zweite Standbein der Schule, die lebenden Fremdsprachen, haben durch die Globalisierung von Wirtschaft, Industrieproduktion, Wissenschaft ein neues Gewicht erhalten. Die Deutschen müssen, wenn sie die Herausforderung der Zeit bestehen wollen, wieder mehr Fremdsprachen lernen. Also nicht Entweder-Oder, sondern nach Möglichkeit Sowohl-Als-Auch, denn auf dem globalisierten Arbeitsmarkt wird der naturwissenschaftlich-technische Fachmann die besten Chancen haben, der über die besten Fremdsprachenkenntnisse verfügt.
Bei dieser Aufgabe fällt dem Lehrer als Anreger und Vermittler auch heute noch eine entscheidende Rolle zu. Das alte Schulmeisterhandwerk, die sokratische Kunst der “Mäeutik”, der geistigen Hebammenkunst also, ist auch im Zeitalter der Informationstechnologie unverzichtbar.
Meine Damen und Herren,
wir feiern heute mit unserer Schule 75 Jahre Vergangenheit.
Aber die Zukunft beginnt nicht erst am Montag mit der ersten Unterrichtsstunde. Sie hat längst begonnen. Und ein Jubiläum hat die vertrackte Eigenschaft, nicht nur die Frage nach der Vergangenheit zu beantworten, sondern zugleich die neue Frage nach der Zukunft zu stellen. Die Zukunft mit den richtigen Inhalten zu füllen, ist die Herausforderung der Gegenwart. Aber damit ist noch nicht die Frage geklärt, wie Vergangenheit und Zukunft zusammenhängen. Wer keine Vergangenheit hat, so lautet eine alte Wahrheit, hat auch keine Zukunft. Wenn dies stimmt, liegt die Lösung nicht in der Negation, sondern in ihrer klug abwägenden, nach neuen Bedürfnissen modifizierten Fortführung und Verwandlung. Zukunftsfähigkeit wird so zur Veränderungsfähigkeit.
Damit sieht sich der Festredner wieder von seiner Schulzeit eingeholt. Und zwar in Form des Themas, das er Ostern 1953 im Abituraufsatz zu bearbeiten hatte. Zwei Zitate waren zu kommentieren in Form des dialektischen Besinnungsaufsatzes. Das eine aus dem Hamlet: “Dies eine über alles, bleib dir selber treu!” Das andere von Stefan George: “Doch Herr der Zukunft wird sein, wer sich wandeln kann.” Der Neunzehnjährige kam – auf eine kurze Formel gebracht – damals zu der Schlussfolgerung, dass sich selbst nur der treu bleiben kann, der die Fähigkeit zum Wandel besitzt.
Der ehemalige Schüler wünscht heute seiner alten Schule:
Bleib dir selber treu! Bleib ein Ort des Lernens, wo das Maß der Anstrengung das Maß der Freude und Befriedigung über den Lernerfolg bestimmt. Aber bleib oder werde zweitens auch so wandlungsfähig, dass du die Herausforderung der Zukunft zu erkennen und zu bestehen vermagst.
Oder sagen wir es mit den Worten eines großen Frankfurters, der im letzten Jahr sein Jubiläum feierte:
“Und wenn Du das nicht hast,
Dieses stirb und werde,
Bist Du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde!”